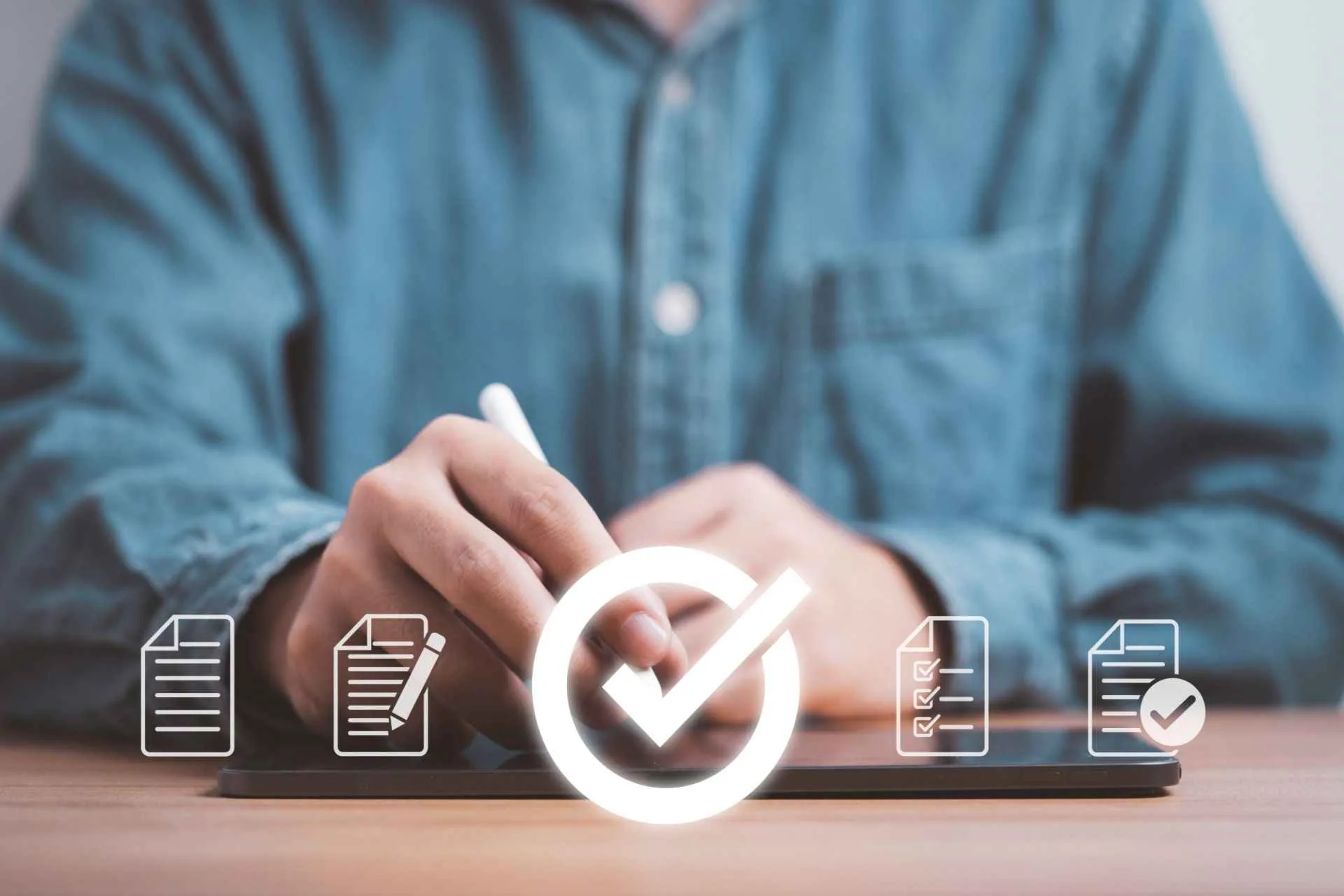Vertrauen ist keine Nebensache
Digitale Identitäten wie die EUDI Wallet können nur dann erfolgreich eingeführt werden, wenn sie auf einem soliden Fundament aus Vertrauen ruhen. Was oft als „Soft Skill“ abgetan wird, ist in Wahrheit eine strategische Schlüsselressource. Die Pilotstudie der Universität Zürich zur digitalen Vertrauensbildung zeigt klar: Ohne digitales Vertrauen bleibt Digitalisierung ein Stückwerk – auch im Bereich digitaler Identitäten.
Was digitales Vertrauen bedeutet – laut Studie
Die Studie der UZH Digital Society Initiative (Gille, Mpadanes, Zavattaro, 2024) identifiziert vier strategische Ansätze für den Aufbau digitalen Vertrauens – alle relevant für die Implementierung des EUDI Wallets:
Human-zentriert
Vertrauen beginnt im Unternehmen: Führungskräfte, Unternehmenskultur und kontinuierliche Schulung sind essenziell, um ein vertrauenswürdiges Umfeld zu schaffen.
Compliance-orientiert
Zertifizierungen, Audits und Rechtskonformität sind kein Selbstzweck – sie schaffen die Grundlage für rechtswirksame digitale Prozesse. Für QTSPs bedeutet das: Vollständige Erfüllung der eIDAS-2-Vorgaben, einschließlich qualifizierter elektronischer Signaturen und Attribute.
Technikgetrieben
Cybersicherheit, Privacy by Design und sichere digitale Identitäten sind Kernpfeiler für die technische Vertrauensbildung – hier sind QTSPs als Infrastrukturanbieter gefordert.
Staatlich gestützt
Vertrauen entsteht auch durch politische Rahmenbedingungen: nationale Cyberstrategien, E-Governance-Initiativen und staatlich anerkannte Wallets erhöhen die Legitimität und Akzeptanz.
Der EUDI Wallet im Spannungsfeld von Vertrauen und Regulierung
Die eIDAS 2.0-Verordnung verpflichtet alle EU-Mitgliedstaaten zur Bereitstellung einer interoperablen, europaweit nutzbaren Digital Identity Wallet. Doch die gesetzliche Pflicht allein schafft keine Akzeptanz. Aus Sicht eines Vertrauensdiensteanbieters ist klar: Nur wenn Nutzende das Wallet als rechtskonform, transparent und souverän kontrollierbar erleben, wird es tatsächlich verwendet.
Was Bürgerinnen und Bürger erwarten
Vertrauen in digitale Identitätslösungen ist nicht selbstverständlich. Die UZH-Studie nennt konkrete Anforderungen, die sich direkt auf den Wallet-Kontext übertragen lassen:
- Transparente Datenkontrolle: Nutzerinnen und Nutzer wollen nachvollziehen können, welche Daten sie wann und mit wem teilen.
- Sicherheitsnachweise und Zertifikate: Vertrauen entsteht nicht durch Behauptung, sondern durch überprüfbare Standards.
- Zugänglichkeit & UX: Auch Nutzerfreundlichkeit wirkt vertrauensbildend – eine barrierefreie, intuitive Wallet ist ein Muss.
- Krisenrobustheit & KPIs: Die Industrie muss digitale Vertrauensmechanismen messbar und stressresistent machen – z. B. durch Trust-Stresstests.
Die Rolle qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter (QTSPs)
Technologisches Rückgrat
QTSPs stellen Schlüsseldienste wie qualifizierte Signaturen, Attribute, Zeitstempel und Validierungsinfrastrukturen bereit – sie sorgen dafür, dass digitale Transaktionen rechtsgültig und fälschungssicher sind.
Compliance als Basis, nicht als Ziel
Zertifizierungen gemäß eIDAS, ETSI und ENISA sind Mindestanforderungen – doch entscheidend ist, wie sie im Wallet-Kontext umgesetzt werden: nutzerzentriert, transparent und interoperabel.
Vertrauen durch Expertise und Best Practices
QTSPs bringen jahrzehntelange Erfahrung aus regulierten Sektoren wie Banken, Gesundheitswesen oder Cybersecurity ein. Dieses Wissen muss in die Architektur und Governance der EUDI Wallets einfließen – auch durch aktive Mitgestaltung auf EU-Ebene.
Fazit: Vertrauen als Führungsaufgabe – auch im Wallet-Kontext
Die Einführung der EUDI Wallet ist ein Meilenstein für Europas digitale Souveränität. Doch ihr Erfolg steht und fällt mit dem Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Dieses Vertrauen ist keine Worthülse – es muss konkret gestaltet, kommuniziert und gemessen werden.
QTSPs wie Namirial bringen genau die Werkzeuge und Erfahrungen mit, die jetzt gebraucht werden: technische Sicherheit, rechtliche Verbindlichkeit und nutzerzentriertes Design. Der Aufbau digitalen Vertrauens ist damit nicht nur eine Aufgabe der Politik, sondern auch eine Führungsaufgabe für die Industrie – im besten Sinne des Wortes.